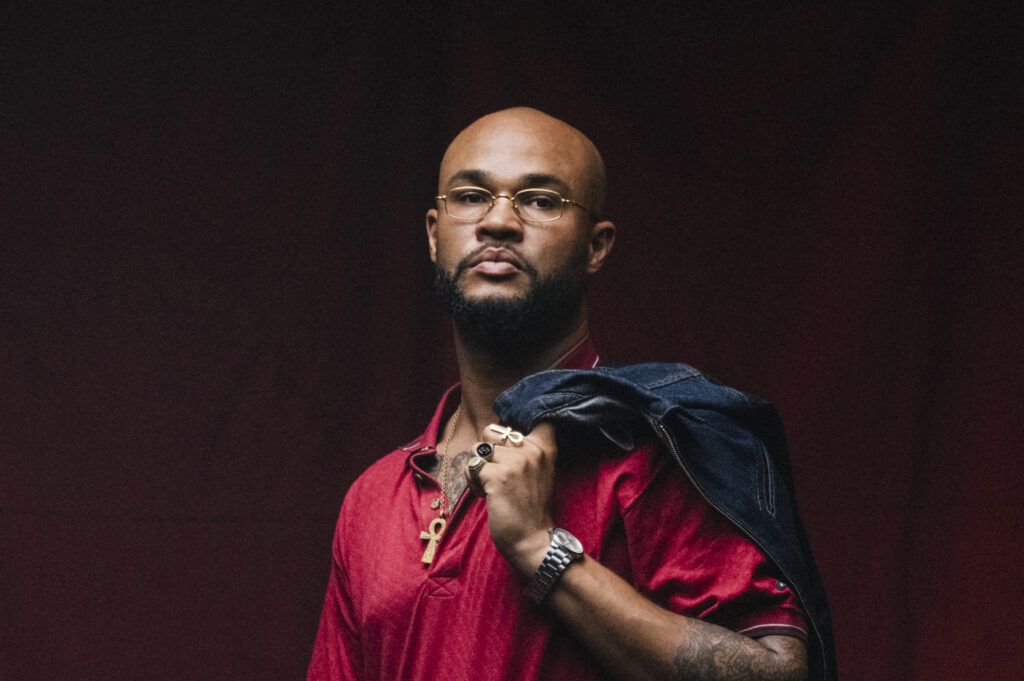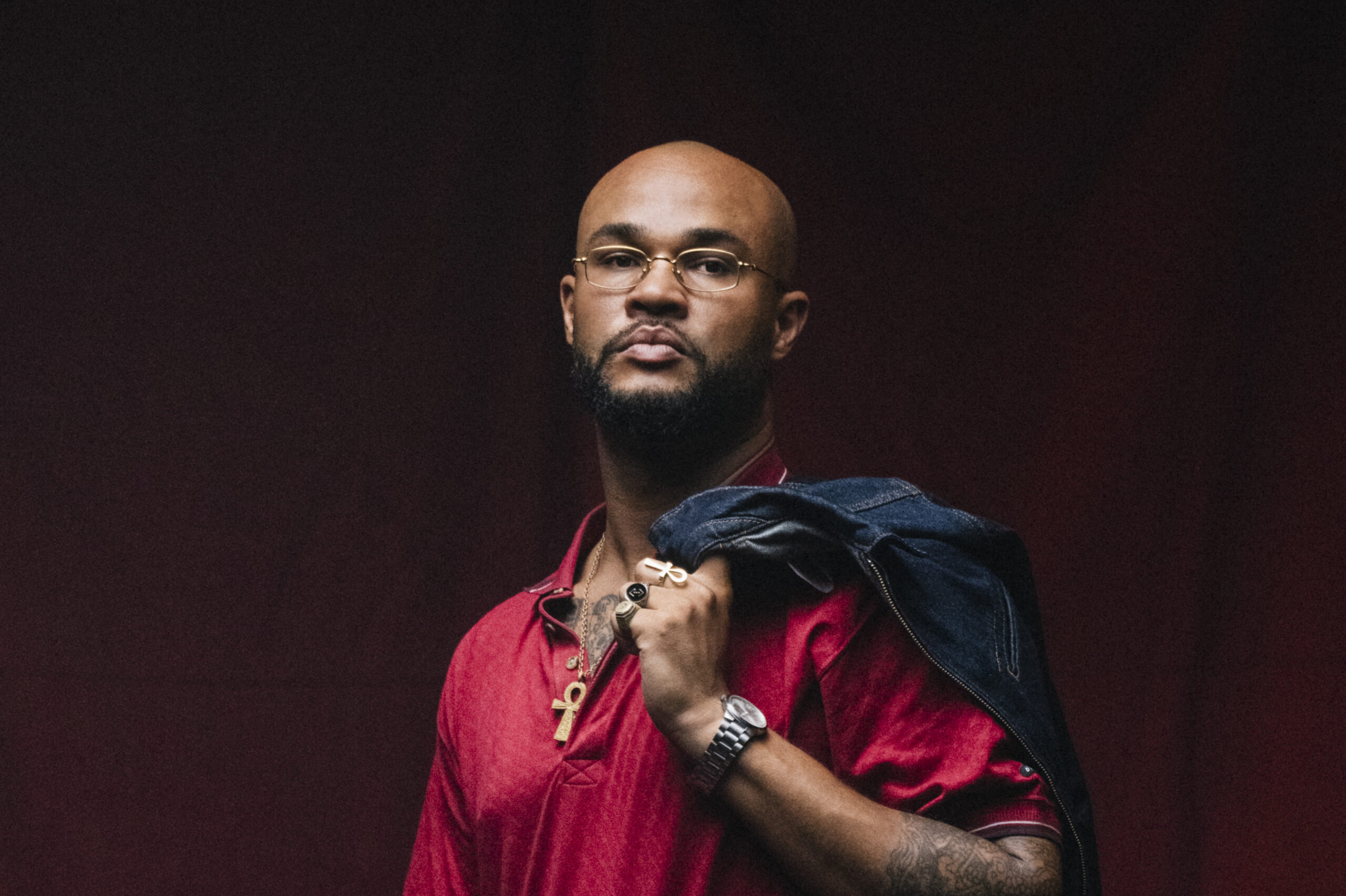Die Luft hing dunstig wie ein feuchter Mantel über der grünen Landschaft auf der Fahrt von Abidjan nach Yamoussoukro. Unterwegs hielten sie in Bassam, einer ehemals kolonialen Hafenstadt an der Küste des Landes. Eine Gruppe junger Männer spielte auf ihren Djembes. Die vibrierenden Rhythmen ließen Thierry nicht mehr los. Seine Augen weiteten sich, und er sog die Musik in sich auf.
Er war sieben Jahre alt, bald acht. Zum ersten Mal besuchte er das Land seines Vaters. Zum ersten Mal betrat er afrikanischen Boden, schnupperte die Luft, die anders roch, als er es bisher kannte. Würziger, irgendwie. Lebendiger. Die Welt war ihm fremd, und doch fühlte er, dass ein Teil von ihm hierher gehörte.
In der Schweiz, im Dorf, in dem er aufwuchs, war sein Zuhause eine Andeutung von Anderssein. „Anders“ – ein Wort, das ihn stets begleitete. Die Wände in der Dreizimmerwohnung, in der er mit seiner Schwester und seiner Mutter die meiste Zeit seiner Kindheit verbrachte, waren bunter gestrichen als bei seinen Klassenkamerad:innen; mal gelb, mal pink. Künstliche Tigerfiguren und Dschungelpflanzen dekorierten das Wohnzimmer.
Anders war auch das Gefühl seinem Vater gegenüber – anders, als er es bei seinen Freunden und Cousins wahrnahm. Wenn Papa anwesend war, erfüllte eine Anspannung den Raum. Eine Strenge, als säßen die Geschwister im Klassenzimmer: sich zusammenreißen, nicht stören, nicht sie selbst sein dürfen. Erst wenn er weg war, wirbelten sie durch die Räume, spielten, schauten ihre Fernsehsendungen, hatten Flausen im Kopf.
Doch auch hier, in Bassam, war seine Empfindung ungewohnt – als er die jungen Beine zum Takt der Trommel wippen ließ und fragte, ob er auch einmal spielen dürfe. Als hätte er das schon immer getan, riss er die gesamte Aufmerksamkeit auf sich und hämmerte rhythmisch auf die fellüberzogenen Instrumente. Alle waren begeistert; seine Mutter, sein Vater, seine Schwester, die Menschen rundherum. Thierry wünschte sich ein eigenes Djembe. Von dem Moment an, als er eines bekam, trommelte er täglich darauf – versunken, in seinem Element, als würde jeder Schlag ein Stück von ihm erzählen.
Doch nicht alle Eindrücke dieser Reise waren von Leichtigkeit geprägt. Ein paar Tage später besuchten sie Thierrys Onkel im Gefängnis. Die Gänge waren dunkel und eng, die Wände feucht, der Geruch nach Schimmel lag schwer in der Luft. Gitterstäbe trennten Welten. Dahinter streckten sich fremde Hände aus – suchend, tastend, als wollten sie sich an etwas Lebendigem festhalten. „Bitte helft uns“ riefen die Gefangenen. Ihre Gesichter eingefallen, müde und vom Leben verlassen. Sie, die Europäer, hinterließen Eindruck in diesem Ort. Der siebenjährige Thierry sog die Bilder auf wie ein Schwamm. Angst kroch in ihn hinein. Faszination. Ein Same wurde gesetzt – für seine immerwährende Frage nach Gerechtigkeit. Die unterschiedlichen Realitäten seiner beiden Herkünfte prägten ihn tief. Seither war die Frage nach Identität keine beiläufige, sondern eine zentrale.
Wer war er – zwischen Bassam und Bern?
Er war ein unsicheres Kind. Der Kern dieser Unsicherheit war seine Identität. Weiße Freunde, weiße Familie – und ein schwarzer Vater. Ein Mann, der einst mit einem Koffer voller schwerer Steine in die Schweiz kam. Steine aus Schmerz, aus Ablehnung, aus Kämpfen, die niemand sah. Wie hätte er einem kleinen Jungen Sicherheit geben können, wenn er selbst noch nach Halt suchte?
Zuhause lebte Thierry mit einem unsichtbaren Geist. Er schwebte zwischen den Räumen, trug die Geschichte seiner afrikanischen Herkunft in sich – eine Geschichte, die selten ausgesprochen wurde, aber immer da war. Thierry fürchtete dieses Erbe, weil er es nicht verstand. Und doch spürte er den Drang, es zu verteidigen.
Vor seinen Freunden, wenn sie beiläufig das Wort „Neger“ benutzten – nicht gegen ihn gerichtet, nur als Schimpfwort, das irgendwo hängen blieb. Vor seiner weißen Verwandtschaft, wenn sie ihn in traditionelle Schweizer Kleidung steckten, weil er so „herzig“ aussah im Sennenhemd, mit seinen krausen Haaren und seiner karamellfarbenen Haut. Nie aus böser Absicht – aber mit einem Blick, der ihn nicht ganz sah. Der ihn liebte, ohne zu fragen, wer er wirklich war.
Zur Trommel kam irgendwann ein Mikrofon hinzu, als Thierry älter wurde. Das Kinderzimmer verwandelte sich in eine Bühne, die Wände wurden zum Publikum. „Was geht ab, Leute!“, rief er den Mauern zu und sah vor seinem inneren Auge eine jubelnde Menschenmenge. Slipknot, System of a Down – er imitierte harte Metalmusik, schrie, trommelte, tobte. Ein wohliges Gefühl durchströmte ihn. Die Trommelschläge und der Schreigesang drangen durch die Kinderzimmertür ins Wohnzimmer, als wollten sie die Welt aufrütteln.
Später verstärkten Musikboxen die Intensität seiner Zimmerauftritte. An freien Nachmittagen war er oft bei seinen Großeltern. Oma strickte, jeden Tag, saß dabei auf dem Sofa und lieh ihm ihre Stricknadel – ein improvisierter Trommelstock, mit dem er auf Opas großen Sitzball einhämmerte. Der Wunsch nach einem echten Schlagzeug ließ nicht lange auf sich warten. Zu Weihnachten war die Freude überwältigend: ein Elektroschlagzeug, ganz für ihn allein.
Dann entdeckte Thierry seine Faszination für Rihanna. Er kaufte sich eine Konzert-DVD. Auf seinem Schlagzeug übte er ihre gesamte Show ein. Sie wusste nichts davon, aber zwischen ausgedienten Kapplaklötzen und dem längst vergessenen gelben Teletubbie Lala sang sie in seinem Zimmer, begleitet von Kickdrum, Snare und Co. Ein Duett, das nur er hörte. Ein Geheimnis zwischen ihm und der Musik.
Lil Bow wow – Take ya home
An einem verregneten Sonntag saß Thierry vor dem Fernseher und schaute auf Viva die Charts. Er sog die Musikvideos auf wie ein Schwamm, doch bei manchen hätte er am liebsten weitergedrückt – sie berührten ihn nicht. In den frühen 2000er-Jahren war das noch nicht möglich. Dann erschien plötzlich ein junger Künstler auf dem Bildschirm, ungefähr in Thierrys Alter. Er strahlte Coolness aus, eine Nonchalance, bewegte seinen Körper im Takt eines energiegeladenen Hip-Hop-Songs, der nach Aufbruch roch, nach Leichtigkeit. Thierry erkannte sich in ihm wieder: ähnliche Hautfarbe, gleiches Alter, derselbe Flow. Lil Bow Wow präsentierte „Take Ya Home“ – und Thierry tauchte tief ein in diese neue Welt.
Sein Musikhorizont weitete sich. Rap, Hip-Hop, Soul, Reggae – Musik, die Kultur trug, Tiefe und Geschichte. Die Melodie spielte weiter, selbst wenn MTV längst ausgeschaltet war und die Boxen verstummt. Die Klänge in seinem Ohr wollten hinaus, wie ein angestauter Fluss, der endlich fließen durfte. Also begann er, selbst zu singen – mit dem Singstar-Programm auf Mamas Computer. CDs wurden gebrannt, Beats heruntergeladen, Texte geschrieben.
Mit seinen Freunden teilte er die Leidenschaft für Musik – aber nicht nur das. Auch die Kultur, die Härte, die Seele dahinter. Thierry wollte mehr. Er lernte neue Leute in Bern kennen, war viel unterwegs. Die ersten Partys. Zum ersten Mal Drogen. Die Welt war ein Abenteuer – und zugleich ein frustrierender Ort für Menschen, die ihren Platz suchten. Für jene, die nach Gerechtigkeit und Freiheit strebten. Ausbildung, Pubertät, Verpflichtungen, Wünsche, Träume. Leben im Rausch. Eine Zeit voller Höhenflüge und Tiefschläge. Drogenkonsum. Grasverkauf. Begegnung mit der Polizei.
Skizzen, die Türen öffneten
Thierry zeigte einem langjährigen Schulfreund einige seiner Skizzen – Texte, Ideen, alles, was er in seinem Zimmer notiert hatte. „Das ist krass, ey!“, sagte Tarik und zeigte sie seinen Freunden. Neue Verbindungen entstanden. Thierry lernte Questbeatz kennen, mit dem er bald darauf ins Studio ging, um einen Song aufzunehmen. Von da an verbrachte er viel Zeit im Studio – ein Raum, der nicht nur Klang formte, sondern auch Lebensstil. Thierry hörte mit dem Kiffen auf und produzierte sein erstes Album: MVZ Vol.1. Weil sie denselben Freundeskreis hatten, lernte er darüber auch seinen späteren Bandpartner Danilo (Dawill) kennen. Er lud ihn ins Studio ein, und weil es zwischen ihnen sofort funktionierte, landete ein gemeinsam produzierter Song auf dem Album.
Das Studio, Bern und die Lorraine wurden zur Begegnungszone für Künstler:innen. Es wurde diskutiert, geträumt, weitergesponnen. Revolutionäre Gedanken, konkrete Ideen. Ein Kollektiv entstand – ein Lebensgefühl, ein Akt der Rebellion gegen ein ungerechtes System: SOS. „Lasst uns Zeichen setzen, die Welt verändern. Wir könnten bei H&M anfangen – mit Schablonen und Farben unsere Initialen auf die Klamotten sprayen“, schlug Nina vor, die damals Teil dieser aktivistischen Clique war. Die Aktion wurde nie durchgeführt. Ziemlich schnell wurde klar: SOS wurde nur noch durch eine Brille betrachtet – die der Musik.
Als Thierry plötzlich die Möglichkeit bekam, seine musikalische Karriere in den USA voranzutreiben, kam die Frage auf, wie es weiterging. Alles lief gerade so gut. Warum wollte er weg? „Es kann uns alle nur weiterbringen“, sagte Thierry. Aber dann kam die Absage aus den USA – ein Glück. Von diesem Moment an schrieb SOS ein neues Kapitel.
Thierry und Danilo fanden sich von heute auf morgen zwischen kreischenden Fans und Jugendlichen wieder, die Selfies mit ihnen machen wollten. Sie wurden für Auftritte gebucht, ins Fernsehen eingeladen, gaben Interviews im Radio. Keine Zeit, um erwachsen zu werden. Keine Zeit, sich mit dem rasenden Tempo anzufreunden, das aus zwei Teenagern bekannte junge Männer gemacht hatte. Überforderung. Zweifel. Eindrücke und Erlebnisse, die die meisten in ihrem Alter nie erleben würden. Komplimente und Kritik von allen Seiten. Türen, die sich öffneten. Augenpaare, die beobachteten. War alles zu viel?
Denn Thierry und Danilo wurde klar: Sie waren viel zu früh mit Situationen konfrontiert worden, denen sie noch nicht gewachsen waren. Sie trennten sich. Jeder suchte seinen Platz in der Schweizer Musikindustrie.
„Dawill ist ein großartiger Künstler. Ein einzigartiger Mensch. Er gehört zu den authentischsten Menschen, die ich kenne. Die Zeit mit ihm war für mich unglaublich bereichernd. Aber wir waren zu jung und hatten nicht genug Zeit, gemeinsam herauszufinden, wer wir waren und was wir wollten. Alles ging so schnell. Wir mussten unseren Weg getrennt fortsetzen.“
Je heller das Licht, umso grösser wird auch der Schatten
Wie viele Künstler:innen im Rampenlicht erlebte Thierry, was es bedeutet, wenn nicht alle es gut mit einem meinen. Wenn sich Türen öffnen – und hinter jeder auch eine Falle lauern kann. Wer sich zeigt, wer sein Leben öffentlich macht, wird zum Magnet. Für jene, die wirklich sehen. Und für jene, die ihre Projektionen und Urteile hineinwerfen.
Und am schmerzhaftesten war die Erkenntnis, dass es manchmal gerade jene waren, die scheinbar dieselbe Weltsicht teilten wie er, die am wenigsten Raum für Weiterentwicklung ließen. Die am schnellsten urteilten. Die am wenigsten verziehen.
Es gab Zeiten, da fehlte die Kraft, sich abzugrenzen vom Außen. Den Blick nach innen zu richten. Sich zu fragen: Schaffe ich das noch?
Eine dunkle Wolke zog bei ihm ein. Sie ließ sich nur schwer vertreiben. Nahm besonders dann viel Raum ein, wenn die Maske aufgesetzt werden musste: Performen. Liefern. Lächeln. Funktionieren. Erwartungen erfüllen. Das Leben wurde zum Marathon – ein Rennen gegen sich selbst, aber auch gegen die Angst zu versagen. Nicht genug getan zu haben. Für die Welt. Für die anderen. Für sich.
Thierry wollte sich daran erinnern, dass es normal ist, Fehler zu machen. Mensch zu sein – mit all den Nuancen, all den Gefühlen. Dass Verletzlichkeit keine Schwäche ist, sondern eine Stärke, die geschützt werden darf.
Er zog sich zurück. Ging auf Reisen. Suchte nach Antworten auf Fragen, für die ihm das Leben lange keine Zeit gelassen hatte. Lernte Menschen kennen, die ihn roh sahen: Ohne Erwartung. Ohne Urteil. Ohne Projektion.
Marrakech. Elfenbeinküste. Nigeria. Paris. Die Welt hörte nicht dort auf, wo seine Glaubenssätze Mauern gezogen hatten. Dahinter war mehr. Er wollte es herausfinden. Spüren. Sich selbst verzeihen – den anderen auch. Niemand ist perfekt. Wir alle sind für inneres Wachstum geschaffen. Niemals stehen bleiben. Den Horizont erweitern.
Die Melodie in seinem Ohr wurde wieder lauter. Frischer. Sie wollte hinaus. Die Worte legten sich wie von selbst aufs Papier. Das Studio wurde zum Ort, an dem Brücken gebaut und Mauern gesprengt wurden. Neue Lieder entstanden. Thierry hörte sie – immer und immer wieder.
Als er im Flugzeug saß, auf dem Rückflug von Nigeria, schlief er ein. In seinen Ohren: sein eigenes Album. Bilder tauchten auf – vom Markt in Lagos, wo ihn seine Begleiter umringten, die Hand an der Waffe, bereit, ihn zu schützen. Vor Kriminellen. Vor Angriffen. Er dachte an den Sonnenuntergang am Strand, an den salzigen Duft der Luft, die seine Lungen reinigte.
Die Songs plätscherten vor sich hin, wickelten ihn in einen wohligen Schlaf. Plötzlich spürte er eine Hand auf seiner Schulter.
„Wach auf. Wir sind da. Wir sind zu Hause“, sagte eine fremde Person.
Thierry öffnete die Augen. Sah, wie das Flugzeug den Boden berührte. Der letzte Song auf seinem Album verklang, und verabschiedete sich mit einem einzigen Wort: Reset.